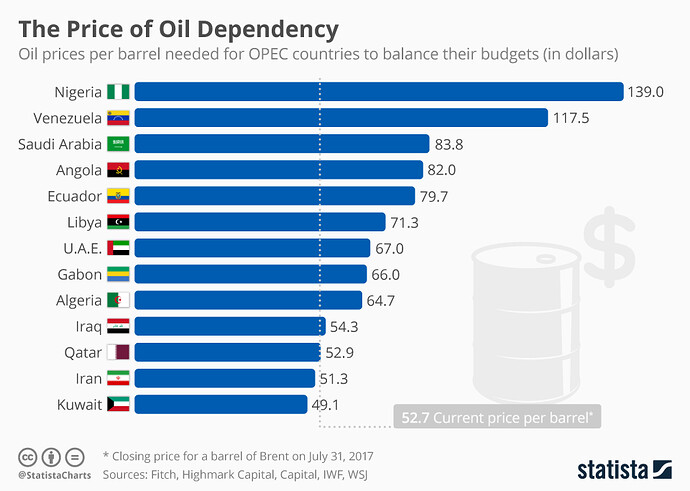Die Klimakosten über den CO2-Preis zu wälzen und dadurch die gewünschte Lenkungswirkung zu erzielen halte ich für den richtigen Weg. Aber der scheint politisch mühsam - wie man am wenig ambitionierten EEG21 sieht. Das Kernproblem ist weiterhin die sektorspezifische Regulierung für Strom, Verkehr und Gebäude/Wärme, wie das Beispiel mit dem Elektroauto aus der Folge veranschaulicht.
Energie ist derzeit sehr unterschiedlich teuer: 1 kWh Strom kostet mich als Endverbraucher gut 30ct, wohingegen 1kWh Wärme aus Gas nur mit 7ct zu Buche schlägt. Aber um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir alle Sektoren einbeziehen, nicht nur den Stromsektor: Verkehr und Gebäude machen jeweils ca. 30% des deutschen Energieverbrauchs aus (ich klammere hier den grauen Energieverbrauch durch Import von Gütern mal aus).
An dieser sehr großen Differenz würde selbst ein doppelt oder dreifach höherer CO2-Preis wenig ändern, weil der Strompreis für Endverbraucher größtenteils aus Umlagen besteht: EEG-Umlage, Netzgebühren, Konzessionsabgabe, KWK-Umlage, Stromsteuer, und wohl noch ein paar, die ich nicht im Kopf habe. Alleine, dass es eine eigene Stromsteuer gibt anstatt einer allgemeinen Energiesteuer zeigt, wie wenig ernsthaft wir den Klimawandel bekämpfen.
Wenn wir wirklich alle Sektoren dekarbonisieren wollen, dann führt an Grünstrom kein Weg vorbei. Und dann reichen die Ausbauziele des EEG21 bei weitem nicht aus - denn irgendwoher muss ja die Energie kommen, die bislang fossil für Verkehr und Wärme aufgewendet wird, plus die zusätzliche Energie für unser Wirtschaftswachstum, Bis 2050 müssten wir also insgesamt die Stromproduktion mehr als verdreifachen. Wenn wir heute im Mittel etwa 40% Grünstrom haben, auf 100% wollen und die anderen Sektoren dazukommen, brauchen wir etwa acht mal mehr Grünstromproduktion als heute.
Die Rechnung ist aber leider noch etwas komplizierter, weil dies nur der aktuell verbrauchte Strom ist. Das Grünstrom-Angebot fluktuiert aber erheblich, sowohl kurzfristig als auch saisonal. Die installierte Peak-Leistung muss daher nochmals um eine Größenordnung höher liegen, und wir brauchen die Speicher und die Netze, um Erzeugung und Bezug auszugleichen.
Daran sieht man das zweite große Problem der Regulierung: Aktuell werden fast alle Kosten auf den Arbeitspreis umgelegt - pro kWh, obwohl die Grenzkosten von Grünstrom nahe null sind - jede zusätzlich erzeugte kWh kostet fast nichts, denn es ist ja kein Brennstoff dafür nötig. Wir haben aber hohe Fixkosten für die Netze und Speicher. Diese Kosten werden sozialisiert, aber gerade die Großverbraucher sind davon ausgenommen. Dass ich auf selbst erzeugten Strom Umlagen entrichten muss, erscheint unverständlich und wird in der öffentlichen Diskussion scharf kritisiert; dahinter liegt aber die „Versicherung“ die ich mir einkaufe durch den Anschluss an das Stromnetz, welche eben dummerweise pro kWh abgerechnet wird. Das Entgelt- und Umlagesystem stammt aus einer Zeit der fossilen Großkraftwerke, mit dominierenden Brennstoffkosten. Transparenter wäre es inzwischen, die Netzanschlüsse pauschal zu verrechnen, z.B. nach Anschlussleistung. Dann wäre der kWh-Preis viel niedriger und der Effekt des CO2-Preises sehr direkt spürbar.
Neben den echten Fixkosten sind ein zweiter wichtiger Bestandteil der Netzentgelte die Kosten für die sog. Systemdienstleistungen. Dahinter verbirgt sich z.B., dass ein Engpass im Netz behoben wird indem ein Kraftwerk vor dem Engpass heruntergefahren wird (z.B. ein Windpark im Norden), und stattdessen ein Kraftwerk hinter dem Engpass hochgefahren (z.B. ein Kohlekraftwerk im Süden). Wir bezahlen also zusätzlich dafür, dass Grünstrom durch Schwarzstrom ersetzt wird, weil das Netz nicht ausreicht oder durch den billigen Strom aus Braunkohlekraftwerken „verstopft“ ist.
Denn - letzter Punkt - der Strommarkt in Europa ist als „Kupferplatte“ organisiert. Die Regulierung tut so, als könnte Strom ohne Verluste von jeden Ort an jeden anderen geliefert werden. Der dann aber physikalisch nötige Ausgleich landet als Kosten in den Netzentgelten. Das Marktdesign ist ist nicht gottgegeben oder irgendwie „natürlich“, sondern tatsächlich ein regulatorisches „Design“. Bislang traut sich die Politik nicht, den Strommarkt wirklich EE-freundlich umzugestalten, der Große Wurf bleibt auch diesmal aus. Der Fairness wegen: Die wissenschaftliche Welt scheint sich derzeit auch nicht einig zu sein, wie das optimale Marktdesign aussieht. So wird eben stückweise reformiert und rumprobiert.
![]() ).
).